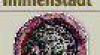Die Gret - ist das vielleicht eine alte Frau? Nein, eine Frau ist damit nicht gemeint, mit der Stadtgeschichte hat die Gret jedoch sehr viel zu tun. Im Zeitalter modernster Logistikzentren mutet dieser Begriff sehr fremd und missverständlich an, dabei war im Mittelalter eine Gret nichts anderes als eine ähnliche Einrichtung, in der gegen eine entsprechende Gebühr Kaufmannswaren geschützt und sicher verwahrt werden konnten.
Mit der Erlaubnis Kaiser Karls IV. das Dorf Ymmendorff zur Stadt zu machen, hat sich Heinrich Graf zu Montfort im Jahre 1360 auch das Geleitrecht auf der damaligen Landstraße vom Joch bis an den Bodensee gesichert. Wir gehen wohl nicht fehl in der Annahme, dass der Kaiser damit einer Bitte des stark wirtschaftlich orientierten Grafen nachgekommen ist, der sicherlich schon mit einem Niederlagsrecht in seiner jungen Stadt spekuliert hat. Aus der Geleitsverleihung ergibt sich aber auch, dass auf dieser bereits 1308 genannten Strecke damals ein beachtenswerter Verkehr gelaufen ist, durch den nun entsprechende Mittel in die Kasse des Grafen und seiner Stadt gespült werden sollten.
Mit einer Gret oder Niederlage war im Mittelalter für durchziehende Kaufleute die Pflicht verbunden, die Güter gegen Gebühr für einen gewissen Zeitraum abzusetzen. Voraussetzung dafür aber war die Bereitstellung eines Gebäudes, in dem die Waren gelagert werden konnten. Es ist also davon auszugehen, dass in der noch recht jungen Stadt durch den Grafen umgehend eine Möglichkeit zur Unterbringung des Handelsgutes geschaffen worden ist.
Unzufrieden mit Gebühren
Ob dafür zuerst ein Gasthof ausgereicht hat oder ein eigenes Bauwerk errichtet wurde, wissen wir nicht. Vermutlich waren die Nachfahren von Graf Heinrich mit den aus dem Geleit- und Niederlagsrecht eingehenden Gebühren nicht ganz zufrieden. Fiel doch ein beträchtlicher Teil davon schon an der Zollbrücke bei Stein in die Kasse des Bischofs von Augsburg.
1478 hat dann Hugo Graf zu Montfort bei Sonthofen eine eigene Brücke mit Zollhaus errichtet und den Verkehr auf das Gebiet seiner Grafschaft Rothenfels geleitet. Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss deshalb für Immenstadt ein eigenes Gretgebäude angenommen werden.
Sein Standort ist wohl am heutigen Marienplatz zu suchen, dort wo 1550 das Amtshaus (später Schloss) errichtet worden ist. Um diese Zeit nämlich wurde der Gret- und Salzstadel von Hugo zu Montfort vor das Sonthofer Tor verlegt. 1597 bezeugte ein Bürger: "Er gedenke wol daß vor dem pfaffenthor kein haus gewest, aber jezo sei der gretstadel und 3 oder 4 häuser da . . ."
Existenzgrundlage für Wirte
So eine zentrale Einrichtung wie eine Gret ermöglichte naturgemäß auch Wirten und Handwerkern eine gute Existenzgrundlage. Um 1550/60 durfte der alte Montforter Vogt Hans Schmid als Erster vor das Tor bauen, daraus begründete sich die Wirtschaft "Zum Goldenen Lamm". Mit ihm zog auch der später "Gretstadelschmied" genannte Ratsherr Christa Landerer vor das Tor. Dann errichtete man die Gasthöfe "Zur Sonne", "Zur Krone" und "Zum Goldenen Engel". In der Nähe des Letzteren stand der große Rodstadl zum Einstellen der vielen, ankommenden Pferde. Auch Fassbinder, Küfer und Wagner waren dort angesiedelt.
Der Immenstädter Gretstadel war ein mächtiger Fachwerkbau, etwa 48 Meter lang, rund 13 Meter tief und ungefähr 14 Meter hoch. Bezeichnend für die Bauweise im Alpenraum war seine Landernbedachung. Er umfasste drei Stockwerke mit einer Lagerfläche von rund 1100 Quadratmetern und lag gegenüber dem heutigen Gasthof "Engel". Im obersten Stockwerk befand sich eine handbetriebene Aufzugsmaschine. Die Lagerböden wurden von zwei gewaltigen Säulen aus Holz gestützt. Der oberste Stock wurde an den Jahrmarkttagen vom Handwerk als Ausstellungshalle genutzt.
So wie die Güterrod durch die Verschiebung der europäischen Handelsachsen im 16. Jahrhundert abnahm, stieg der Anteil des Salztransportes aus Tirol. Der Begriff "Gretstadel" verlor sich, es blieb der Name "Salzstadel".
Bis 1813/14 lagerte dort ausschließlich Salz aus der Saline von Hall/Tirol. 1823 kam dann letztmals Salz aus dem Inntal über das Joch nach Immenstadt. Von nun an wurde durch die "Baierische Salzoberfaktorie Immenstadt" ausschließlich bayerisches Salz in den Handel gebracht. Nachdem diese Organisation 1860 ihren Betrieb eingestellt hatte, kaufte 1872 die Stadt das mächtige Gebäude vom Staat, veräußerte es aber 1883 an den Maurermeister Christian Höss mit der Auflage, den "Schandfleck" innerhalb von zehn Jahren zu beseitigen. 1894 erfüllte Höss diese Auflage.
Auf dem Gelände der historischen Immenstädter Gret stehen heute die Gebäude Kirchplatz 5 (Fleschhut) und Salzstraße 1 (Eberl-online).